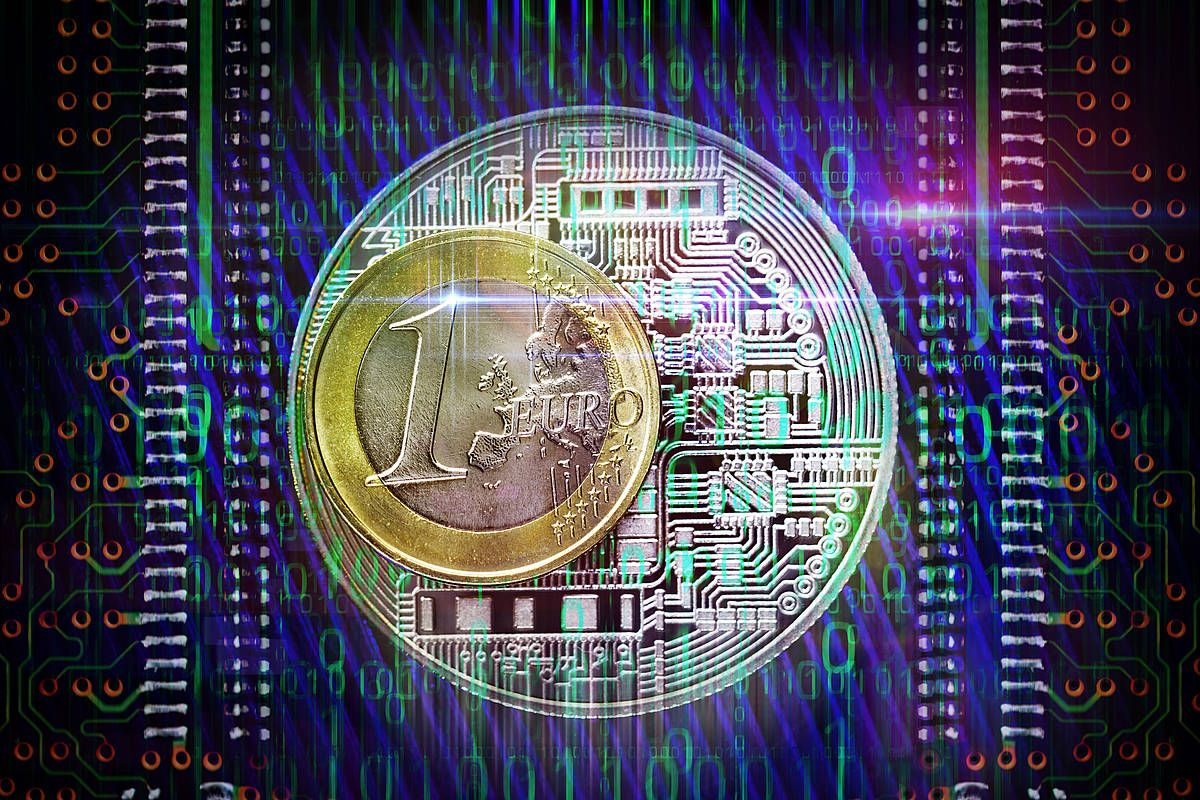
Artikel
31.12.2025
Standpunkt: Digitaler Euro
Klare Rollenverteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft
Kernforderungen
- Doppelstrukturen vermeiden: Kein Aufbau eines staatlichen Zahlungssystems durch die EZB
- Integration des Digitalen Euros in bestehende privatwirtschaftliche Strukturen
- Digitaler Euro als digitales Bargeldäquivalent ausgestalten
- Haltelimit von 500 € pro Nutzer festlegen
Den gesamten Standpunkt finden Sie in der Anlage.
Fotocredit: Picture Alliance
Dr. Christian-Friedrich Hamann
Leiter
Stab Politik und Wirtschaft

